28. Mai 2024Peter Pionke
Erinnerungen an E.M. Forsters Buch: „Auf der Suche nach Inden“
 Dr. Sandra Heinen, Professorin für Anglistik an der Bergischen Universität – © Foto: Berenika Oblonczyk
Dr. Sandra Heinen, Professorin für Anglistik an der Bergischen Universität – © Foto: Berenika OblonczykEdward Morgan Forster gehört zu den wichtigsten englischen Autoren des 20. Jahrhunderts. Welche Gründe sind dafür ausschlaggebend?
Sandra Heinen: „Die Prozesse literarischer Wertung sind komplex und werden von vielen Faktoren beeinflusst. Wenn man den Grund für das anhaltende Renommee des Autors in den Romanen selbst suchen will, ist meines Erachtens die Verquickung von kulturspezifischen und universellen Themen zentral. Forsters Texte thematisieren einerseits Fragen, die charakteristisch für die Mentalität der klassischen Moderne sind. Es ist eine Zeit weitreichender Veränderungen, die bis heute nachwirken und die daher weiterhin interessieren.
Andererseits bearbeiten Forsters Romane aber auch Themen, die epochenübergreifende Relevanz besitzen, wie zum Beispiel das Verhältnis von innerem und äußerem Leben oder die Frage, ob und wie es möglich ist, soziale und kulturelle Schranken zu überwinden. Durch diese Verbindung von Speziellem und Allgemeinem eröffnen die Texte Einblicke in die Zeit ihrer Entstehung, sind aber nicht zu reinen Zeitdokumenten geworden, sondern sprechen Leserinnen und Leser immer noch an.
Darüber hinaus mag auch die Tatsache, dass Forster in ‚Aspects of the Novel ‚(Ansichten des Romans) eine Romantheorie formuliert hat, die im literaturwissenschaftlichen Diskurs Beachtung gefunden hat, die Rezeption seiner Romane befördert haben. Sicherlich haben Forsters Zugehörigkeit zur berühmten Bloomsbury Group und die preisgekrönten und kommerziell erfolgreichen Verfilmungen der Romane zur heutigen Stellung des Autors beigetragen.“
Worum handelte es sich bei der Bloomsbury Group?
Sandra Heinen: „Die Bloomsbury Group war ein Kreis von befreundeten (sowie zum Teil auch verwandten oder verheirateten) Künstlerinnen und Künstlern sowie Intellektuellen, die zu regelmäßigen Treffen zusammenkamen und den englischen Modernismus entscheidend prägten. Benannt ist die Gruppe nach dem Londoner Stadtteil Bloomsbury, in dem viele der Treffen stattfanden. Wichtiger Treffpunkt war ein Haus am Gordon Square, in dem die berühmte Schriftstellerin Virginia Woolf ab 1904 zusammen mit ihren drei Geschwistern lebte.
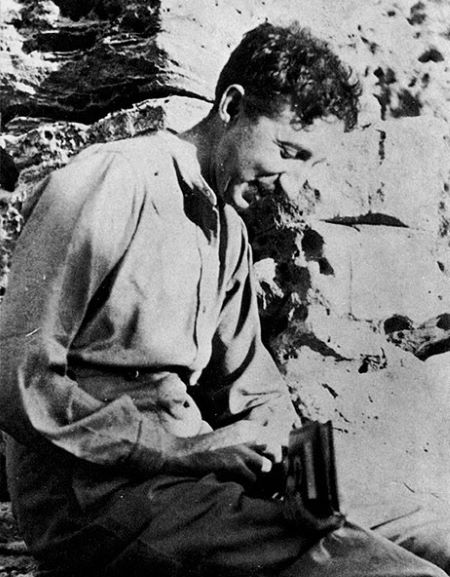 Der britische Autor E.M. Forster (1917) – © gemeinfrei
Der britische Autor E.M. Forster (1917) – © gemeinfreiWeitere namhafte Personen, die der Gruppe zugerechnet werden, sind der Kunstkritiker Clive Bell, die Malerin Vanessa Bell (Virginia Woolfs Schwester), der Maler Roger Fry, der Maler Duncan Grant, der Ökonom John Maynard Keynes, der Autor Lytton Strachey, der Verleger Leonard Woolf (Virginia Woolfs Ehemann), – und ab den 1910er Jahren auch E.M. Forster. Der intellektuelle und künstlerische Austausch beeinflusste die Arbeiten der Mitglieder stark. Gemeinsam steht die Gruppe für die englische Ausprägung des Modernismus als kulturelle Hochphase des frühen 20. Jahrhunderts.“
Am 4. Juni 1924 erschien A Passage to India, sein letztes Werk. Worum geht es in dem Roman?
Sandra Heinen: „Hauptthema von ‚A Passage to India‘ (Auf der Suche nach Indien) ist das Verhältnis zwischen Briten und Indern in der britischen Kolonie Britisch-Indien in den 1920er Jahren. Die Geschichte spielt größtenteils in Nordindien, an einem Ort, an dem die britischen Kolonialherren einen Stützpunkt errichtet haben, von dem aus sie das Land beherrschen. Aus England reisen zwei Frauen an, für die das Land neu ist und die es gerne kennenlernen wollen. Ihre Versuche, dem ‚wirklichen Indien‘ zu begegnen enden in einem Gerichtsverfahren, in dem ein junger indischer Arzt angeklagt ist, die jüngere der Frauen unsittlich berührt zu haben. Zwar zerschlagen sich die Anschuldigungen, aber Vertrauensverhältnisse, die sich zwischen indischen und englischen Figuren zuvor vereinzelt entwickelt haben, sind am Ende des Romans fundamental erschüttert.“
Man spricht bei diesem Roman auch vom ‚Prototyp der postkolonialen Literatur‘. Was bedeutet das?
Sandra Heinen: „Der Begriff ‚postkolonial‘ wird heute in unterschiedlichen Bedeutungen verwendet. Zuweilen wird postkoloniale Literatur durch die Herkunft definiert. Dann wären ihr vor allem Texte zuzurechnen, die in vormals kolonialisierten Ländern entstehen. Eine andere Begriffsverwendung, die aufgrund des Präfixes ‚post‘ oft mitschwingt, legt den Fokus auf die Entstehungszeit und betrachtet postkoloniale Literatur vorrangig als Literatur, die retrospektiv auf eine vergangene Kolonialzeit zurückblickt. Im Sinne dieser beiden Begriffsverwendungen ist „A Passage to India“ kein postkolonialer, sondern – gewissermaßen das Gegenteil – ein kolonialer Roman, denn er wurde mehr als 20 Jahre vor der indischen Unabhängigkeit und zudem von einem Europäer verfasst.
 © Bergische Universität
© Bergische UniversitätEs gibt aber mindestens zwei konkurrierende Begriffsbestimmungen, denen zufolge A Passage to India durchaus als postkolonialer Roman bezeichnet werden kann. Einer bekannten Definition zufolge beginnt Postkolonialität nicht mit der Dekolonialisierung, sondern bereits mit Beginn der Kolonialisierung, die für beide beteiligten Gesellschaften tiefgreifende Veränderungen mit sich bringt. Eine weitere Begriffsverwendung schließlich definiert ‚postkolonial‘ weder zeitlich noch räumlich, sondern als Haltung. Literatur wäre demnach postkolonial, wenn sie Kolonialismus oder allgemeiner: Ausbeutungsstrukturen jeder Art kritisiert.
Dies geschieht in „A Passage to India“ unmissverständlich mit der Darstellung der englischen Kolonialisten. Auch macht Forster mit dem Arzt Dr. Aziz eine indische Figur zum Protagonisten der Handlung und räumt so der indischen Perspektive viel Platz ein. Dies wird schon in der ersten Szene des Romans deutlich, in der mehrere Inder über die Frage diskutieren, ob man (als Inder) mit einem Engländer befreundet sein kann. Andererseits bleibt Forster in einigen Punkten dem kolonialen Diskurs treu, indem er orientalistische Stereotype des ‚Anderen‘ reproduziert. Der Text ist daher beides: Ein Produkt des kolonialen Diskurses und sehr nachdrücklich vorgebrachte Kritik an diesem.“
Viele von Forsters Werken wurden in den 1980er und 1990er Jahren verfilmt: A Passage to India (Reise nach Indien, 1984), Room with a View (Zimmer mit Aussicht, 1985), Maurice (1987), Where Angels Fear to Tread (Engel und Narren, 1991) und Howards End (Wiedersehen in Howards End, 1992). Warum erst so spät?
Sandra Heinen: „Forster hatte keine hohe Meinung vom Film und lehnte fast alle entsprechenden Anfragen ab. Er selbst willigte nur in die Produktion von zwei Fernsehfilmen der BBC ein: 1965 wurde eine Verfilmung von Santha Rama Raus Theateradaption von A Passage to India gesendet (Regie: Waris Hussein); 1966 folgte die Verfilmung der Kurzgeschichte „The Machine Stops“ (Regie: Philip Saville). Erst mehr als eine Dekade nach Forsters Tod im Jahr 1970 wurden durch die Nachlassverwalter weitere Filmrechte vergeben.
 E. M. Forster – Doktor honoris causa 1954 in Leiden (Niederlande) – © CC BY 4.0
E. M. Forster – Doktor honoris causa 1954 in Leiden (Niederlande) – © CC BY 4.0Die Rechtefreigabe erfolgte in einer für die Realisierung günstigen Phase: Sogenannte Heritage-Filme, die die britische Vergangenheit in aufwändigen Historienfilmen repräsentierten und dabei vor allem auf literarische Vorlagen zurückgriffen, dominierten in den 1980er und 1990er Jahren die britische Filmindustrie. Das Interesse an historischen Stoffen wird heute als Reaktion auf die sozialen Veränderungen betrachtet, die die Politik von Margaret Thatcher mit sich brachte. Eine eigene Untergruppe der Heritage-Filme waren Inszenierungen von Geschichten aus der Zeit der britischen Kolonialherrschaft in Indien, der auch David Leans Verfilmung von „A Passage zu India“ zuzurechnen ist. Forsters Romane passten – wie sonst nur das Werk von Henry James – perfekt zum nostalgischen Blick in die Vergangenheit, für den die Heritage-Filme bekannt wurden.“
Bereits 1909 erschien seine Kurzgeschichte „Die Maschine steht still“, in der er weite Teile der technologischen Entwicklung vorwegnimmt und vor deren Gefahren warnt. Damit ist er heute doch hochaktuell, oder?
Sandra Heinen: „The Machine Stops“ ist der einzige Science Fiction-Text von Forster, steht aber in einer Reihe von fiktionalen Zukunftsszenarien, die in der Moderne entworfen wurden. Ein recht bekannter früherer englischsprachiger Text ist beispielsweise ‚The Time Machine‘ (Die Zeitmaschine, 1895) von H.G. Wells. Wie in anderen Texten des Genres sind auch bei Forster Entwicklungen in der realen Welt Ausgangspunkt für ein Gedankenexperiment, in dem eine mögliche Zukunft konturiert wird. In diesem Fall ist die zunehmende Technisierung der Welt in der Moderne das Phänomen, über dessen mögliche Folgen Forster spekulativ reflektiert.
Die Zukunftsvision, die er entwirft, wirkt stellenweise in der Tat wie eine Überzeichnung aktuell beobachtbarer Entwicklungen: Die Menschen leben nicht mehr in sozialen Gemeinschaften, sondern einzeln in unterirdischen Kammern. Es gibt weder die Notwendigkeit noch den Wunsch, diese Kammern zu verlassen, denn was die Menschen benötigen, wird ihnen durch ‚die Maschine‘ in der eigenen Kammer bereitgestellt. Unmittelbare sinnliche und soziale Erfahrung wird durch Simulationen ersetzt. Die Natur an der Erdoberfläche wurde soweit zerstört, dass ein Aufenthalt außerhalb der maschinenkontrollierten Kammern als tödlich gilt.
Wie in unserem Digitalzeitalter mit seinen virtuellen Welten unterwerfen sich die Menschen bei Forster der Maschine freiwillig, die Einschränkung der Erfahrungswelt und die Abhängigkeit von der Maschine sind also – anders als z.B. in The Time Machine oder Fritz Langs Film Metropolis (1927) – selbstgewählt. Überraschend sind diese Parallelen vor allem deshalb, weil sie die Folgen der Digitalisierung zu antizipieren scheinen, obwohl Forster seinen Text lange vor der Entwicklung des ersten Computers schrieb.
Mit Maurice schuf er bereits 1913/14 einen Roman, der sich mit Homosexualität beschäftigte. Warum wurde dieser Roman erst 1971 posthum veröffentlicht?
Sandra Heinen: „Forster hatte wohl nie vor, den Roman zu Lebzeiten zu veröffentlichen, hat ihn aber im Laufe seines Lebens mehrfach überarbeitet und 1960 auch eine Version für die posthume Publikation vorbereitet. Trotz veränderter Stimmung standen sexuelle Handlungen zwischen Männern auch 1960 noch unter Strafe. Zwar hatte der Bericht einer Kommission, die nach der Verhaftung einer Reihe prominenter Männer von der britischen Regierung eingesetzt worden war, 1957 die Entkriminalisierung empfohlen, aber erst 1967, also zehn Jahre nach der Veröffentlichung des Kommissionsberichts, legalisierte der ‚Sexual Offences Act‘ homosexuelle Handlungen zwischen Männern in England und Wales. Entsprechende Gesetzgebungen für Schottland und Nordirland wurden erst in den 1980er Jahren verabschiedet. Als Forster den Roman Anfang des Jahrhunderts schrieb, war die öffentlichkeitswirksame Verurteilung von Oscar Wilde zu Zuchthaus und Zwangsarbeit noch keine 20 Jahre her und stellte sicher auch für Forster noch ein warnendes Beispiel dar.
Interessant ist in diesem Zusammenhang die Schlussgebung des Romans. Wie eine fiktionale Geschichte ausgeht, wird oft als Form der moralischen Bewertung durch den Autor gelesen: Erlebt eine Figur ein Happy End, scheint dies anzuzeigen, dass der Autor das Verhalten seiner Figur gutheißt und sie daher mit einem glücklichen Ausgang belohnt. Endet eine Geschichte unglücklich, kann dies als Kritik am Verhalten der betroffenen Figuren verstanden werden. Diese Konvention der ‚poetischen Gerechtigkeit‘, die im Roman des 19. Jahrhunderts besonders wirkmächtig war, zeigt sich zum Bespiel daran, dass Bösewichte am Ende von Romanen dieser Zeit selten ungestraft davonkommen, sondern in der Regel auf die eine oder andere Art sanktioniert werden.
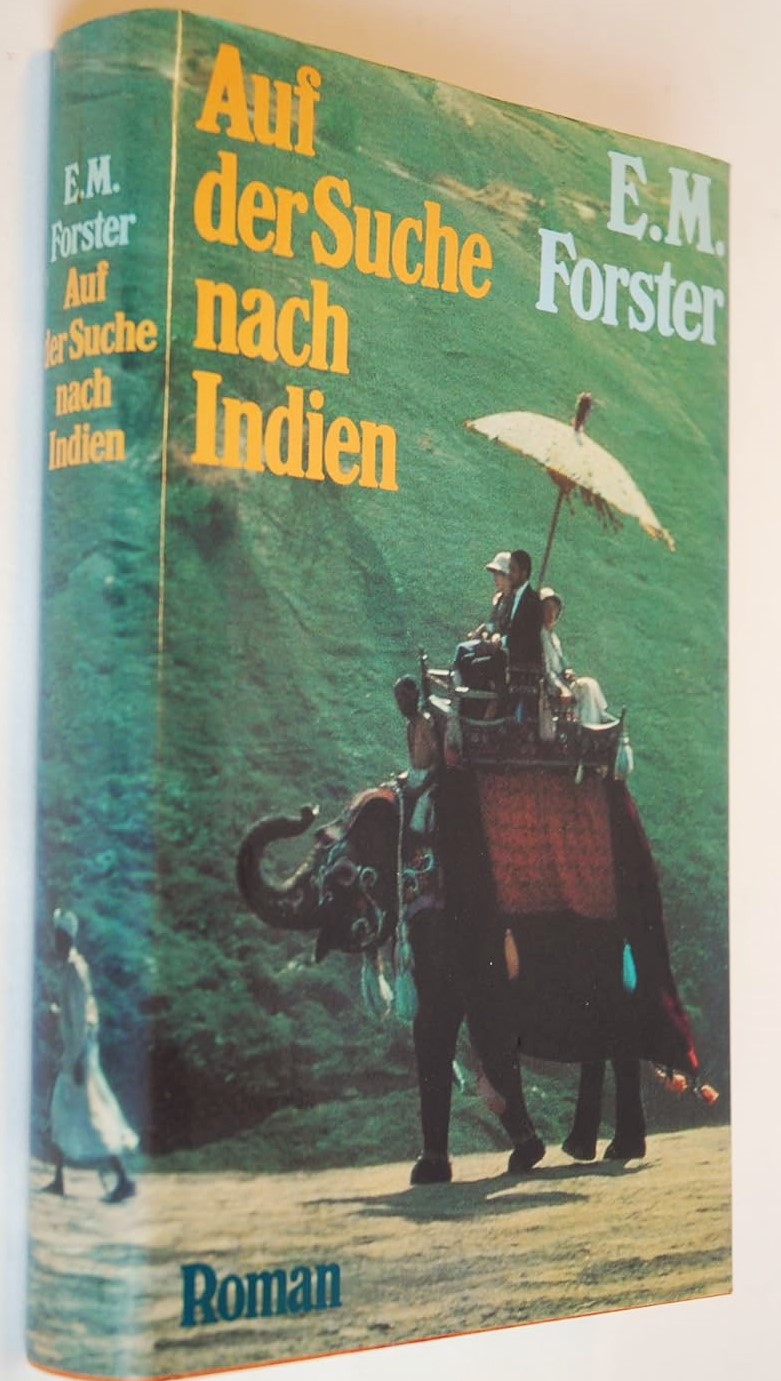 „Auf der Suche nach Indien“ – E.M. Forster – Sweete Story über Amazon – 1. Januar 1985
„Auf der Suche nach Indien“ – E.M. Forster – Sweete Story über Amazon – 1. Januar 1985Nun schrieb Forster im liberaleren frühen 20. Jahrhundert und entwarf – als entschiedenen Gegenentwurf zur Realität – bewusst eine Geschichte, in der Homosexualität nicht bestraft wird. Im Nachwort des Romans beschreibt Forster seine Konzeption rückblickend: „A happy ending was imperative. […] I was determined that in fiction anyway two men should fall in love and remain in it for the ever and ever that fiction allows“. Weil das glückliche Ende von Maurice Homosexualität implizit normalisiert, stand es, wie Forster an gleicher Stelle ebenfalls betont, einer Veröffentlichung zu seinen Lebzeiten im Weg.
Zu Forsters bekanntesten Zitaten zählt der Satz: „Wie kann ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage?“ Was meint er damit?
Sandra Heinen: „Der vielzitierte Aphorismus scheint intuitiv plausibel, ist aber ohne weiteren Kontext deutungsoffen. Bei Forster findet er sich in ‚Aspects of the Novel‘, der Publikation einer Vorlesungsreihe, die Forster 1927 in Cambridge gehaltenen hat und in deren Verlauf er auf unterhaltsame Weise zentrale Gattungsmerkmale des Romans beschreibt. Aus erzähltheoretischer Sicht ist ‚Aspects of the Novel‘ unter anderem wegen Forsters Unterscheidung von Story (Ereignisfolge) und Plot (Folge von Ereignissen mit kausaler Verknüpfung) relevant. Im Hinblick auf den Plot vertritt Forster die Auffassung, dass Romane einen kohärenten und vorab geplanten Plot haben sollten. Zwar können und sollten Autorinnen und Autoren ihre Leser phasenweise über Zusammenhänge im Unklaren lassen, aber sie selbst sollten beim Schreiben den ganzen Plot vor Augen haben.
Forster erwägt Ansätze plan- und plotlosen Schreibens und bezieht sich dazu auf André Gides kurz zuvor erschienen Roman ‚Die Falschmünzer‘ (1925), den er als ‚gewalttätigen Angriff‘ auf den Plot in seinem Sinn betrachtet. Mit einer Anekdote über eine ältere Dame, die auf den Vorwurf, unlogisch zu sein, mit dem bekannten Satz (im Original: „How do I know what I think until I see what I say?“) reagiert, macht sich Forster über Gides demonstrative Verweigerung eines planorientierten Schreibprozesses lustig. Der Satz ist also in „Aspects of the Novel‘ ausdrücklich keine Selbstbeschreibung Forsters, sondern im Gegenteil grenzt Forster seine Herangehensweise von der der älteren Dame und von der von Gide ab.
Dass der Satz so oft zitiert wird, liegt vermutlich daran, dass er eine Alltagserfahrung des Menschen, nämlich der, dass Gedanken oft erst beim Sprechen voll entwickelt werden, in eine griffige und humorvolle Formulierung bringt. Dass es sich hierbei vermeintlich um die Sentenz eines bekannten Schriftstellers handelt, verleiht dem Satz zusätzliches Gewicht. Seine Beliebtheit verdankt sich zudem wohl auch seiner Deutungsoffenheit: Er wurde zur Erläuterung so unterschiedlicher Phänomene wie Kognition, Kreativität oder Unterbewusstsein herangezogen. Ein besserer Gewährsmann für die Idee, dass Versprachlichung das Denken befördert, wäre jedoch Heinrich von Kleist, dessen kurzer Aufsatz „Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden“ (1811) immer noch sehr lesenswert ist.
Forster präsentiert die Anekdote der unlogischen älteren Dame im Übrigen in ‚Aspects of the Novel‘ nicht als eigene Erfindung. Dass Forster nicht der Urheber des bekannten Satzes ist, sondern in der Tat eine kursierende Anekdote wiedergibt, lässt sich anhand einer früheren Publikation des Sozialpsychologen Graham Wallace nachweisen, der bereits ein Jahr vor Forster in seinem Buch ‚The Art of Thought‘ (1926) eine leicht abweichende Version verwendet.“
Uwe Blass
 Prof. Dr. Sandra Heinen – © Foto: Berenika Oblonczyk
Prof. Dr. Sandra Heinen – © Foto: Berenika OblonczykÜber Prof. Dr. Sandra Heinen
Prof. Dr. Sandra Heinen ist in der Anglistik/Amerikanistik der Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften im Bereich der Literatur- und Medienwissenschaft tätig.
Weiter mit:




Kommentare
Neuen Kommentar verfassen