8. Juli 2024Peter Pionke
Genehmigungsverfahren: Logik versus Pragmatismus
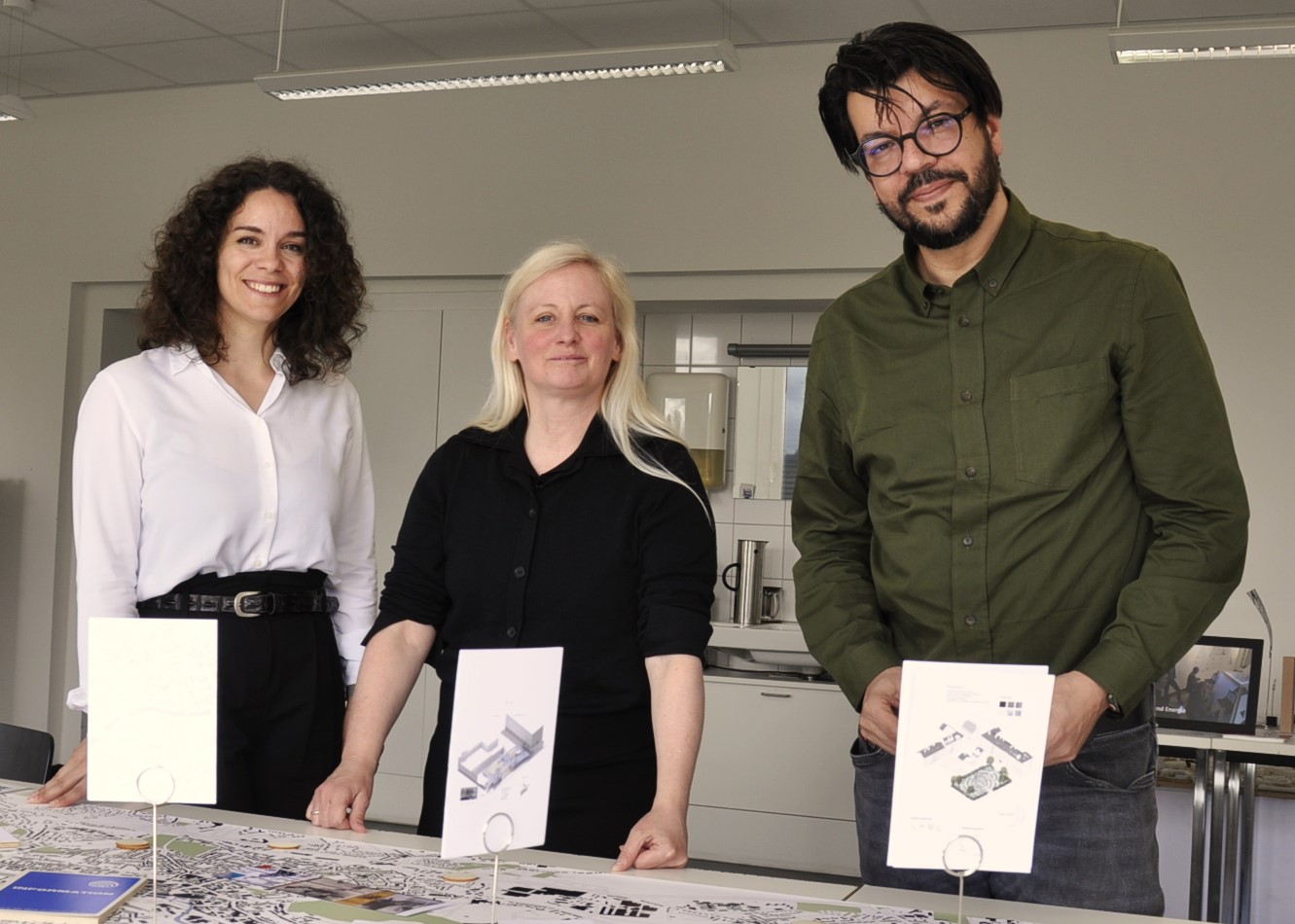 Professorin Dr.-Ing. Tanja Siems (M.) leitet den Lehrstuhl für Städtebau an der Bergischen Universität. Links Architektin Alexia Radounikli, rechts Dipl.-Ing. Mohamed Fezazi – © UniService Transfer
Professorin Dr.-Ing. Tanja Siems (M.) leitet den Lehrstuhl für Städtebau an der Bergischen Universität. Links Architektin Alexia Radounikli, rechts Dipl.-Ing. Mohamed Fezazi – © UniService TransferOb Neubau, Dachausbau, eine zusätzliche Garage oder die Nutzungsänderung eines Gebäudes, alles bedarf eines Genehmigungsverfahrens. Viele Planende und Bauende, aber auch Bürgerinnen und Bürger, die ein solches Unterfangen für Privat- oder Gewerbegebäude starten, geraten in bürokratische Mühlen, bei denen nicht selten Projekte zum Stillstand kommen. Immer neue Richtlinien, die manchmal nicht mehr nachzuvollziehen sind, erschweren die Arbeit.
Wenn bspw. eine Stadt oder eine Gemeinde etwas bauen will, dann muss sie den Auftrag in der Regel deutschlandweit öffentlich ausschreiben. Wenn die Planungsleistungen von Architekten, Ingenieuren und Technikern jeweils allerdings einen Schwellenwert von 215.000 Euro überschreiten, muss sogar europaweit ausgeschrieben werden, was die Bundesregierung befürwortet. Das bedeutet aber einen entschiedenen Mehraufwand sowie wesentliche Mehrkosten für die Auftraggeber.
 © Bergische Universität
© Bergische UniversitätProfessorin Tanja Siems vom Lehrstuhl Städtebau sagt: „Funktionierende urbane Gefüge bestehen immer aus einem ausgewogenen Miteinander, von kultureller Lebendigkeit, einem bewussten Umgang mit der direkten Umwelt und seinen Ressourcen sowie sozialer Gerechtigkeit und ökonomischem Wohlstand.“ Da stellt sich die Frage, ob europaweit ausgeschriebene Bauvorhaben dieser Idee nicht im Wege stehen.
Tanja Siems hat dazu eine ganz klare Meinung: „Ein italienisches Büro z. B. würde sich bei diesem Volumen erst gar nicht darauf bewerben, sie müssten ja sofort eine Zweigstelle in Deutschland einrichten und alles für den Bauprozess Notwendige mitbringen. Das wäre viel zu kostenaufwändig und rentiert sich wirtschaftlich nicht. Anders sieht es vielleicht mit einer Kooperation aus“, fährt die Stadtplanerin fort.
 Bis die Bauarbeiter loslegen können, vergeht oft viel zu viel Zeit – © Pixabay
Bis die Bauarbeiter loslegen können, vergeht oft viel zu viel Zeit – © Pixabay„Wir haben ein städtebauliches und infrastrukturelles Projekt für Brüssel entwickelt, bei dem wir mit Kollegeninnen und Kollegen aus verschiedensten Disziplinen von früher zusammengearbeitet haben. Sie haben uns angesprochen, da unser Büro die Expertise in den Disziplinen Architektur, Städtebau und Verkehrsdesign innehat, die sie in Brüssel für die Ausschreibung brauchten. Das geht aber nur mit totalem Vertrauen. Man würde bei solchen Ausschreibungen nie mit einem Partner, mit dem man noch nicht vorher intensiv zusammengearbeitet hätte, kooperieren. Und das hängt nicht vom Budget ab.“ Solche Ausschreibungen, wie sie sich die Bundesregierung wünscht, scheinen also reines Wunschdenken zu sein.
Europaweite Ausschreibungen meist in Landessprache
Mohamed Fezazi, Mitarbeiter am Lehrstuhl, nennt ein Beispiel, das zeigt, wie das Prozedere in europäischen Architekturwettbewerben läuft. „Bei den europaweit ausgeschriebenen Architektenwettbewerben gibt es Reglements die vorsehen, dass die Entwürfe nur in der Landessprache eingereicht werden können. D. h., wenn ein deutsches Büro bei einem finnischen Wettbewerb mitmachen möchte, ist man meist schlecht aufgestellt. So lange diese Hürden bestehen, spricht man eigentlich nur von einer Fassade.“
Zwar schreibe Deutschland viel in Englisch aus, ergänzt Tanja Siems, aber dann brauche man Geschäftspartner, welche die Sprache besonders in der technischen Ausführung beherrschen. „Zudem muss man sagen, dass eher Großbüros dazu in der Lage sind, solche umfangreichen Projekte zu stemmen. Kleinere Architekturbüros trauen sich das in einem anderen europäischen Land meist nicht zu, weil es vom Arbeitsaufwand nicht zu stemmen ist.“ Und das zeige dann auch schon ein sehr starkes Ungleichgewicht zwischen den großen und den kleinen Unternehmen.

Große Agenturen genießen Vorteile, wenn es schnell gehen muss
Für regionale Unternehmen sind aufwändige EU-Ausschreibungen ein Riesenproblem und sie verlieren dadurch viele Aufträge der öffentlichen Hand. Ein aktuelles Beispiel, wie schleppend der Wiederaufbau nach der Flutkatastrohe im Ahrtal vorangehe, sagt Mohamed Fezazi, zeige sich in der Gemeinde Ahrweiler. „Sie bekommen große Probleme, wenn sie bestimmte Leistungen mit viel Aufwand ausschreiben müssen, denn es ist ein unglaublicher bürokratischer Aufwand, und Bauzeiten werden extrem verlängert. Das ist ein organisatorisches Problem, was sich aber wirtschaftlich auf die Büros ausweitet.“
Meist erhielten die großen Büros direkt die Aufträge, weil sie ähnliche Projekte schon durchgeführt hätten, erklärt Tanja Siems. „Da haben junge, planende und ausführende Büros gar keine Chance, es sei denn, sie können bereits durch Netzwerke ein größeres Portfolio präsentieren.“
Italien und Frankreich zeigen, was in Deutschland nicht geht
In Italien wurde nach dem Einsturz der Morandi-Brücke in Genua 2018 die neue San-Giorgio-Brücke an gleicher Stelle binnen zwei Jahren fertiggestellt. Die Brücke Rahmede in Lüdenscheid wurde 2021 gesperrt, 2023 gesprengt und wird erst voraussichtlich 2026 fertig. Lange Genehmigungsverfahren führen zusätzlich auch dazu, dass hiesige Unternehmen im Ausland bauen.
 Bauvorhaben werden oft durch überlange Genehmigungsverfahren ausgebremst – © Pixabay
Bauvorhaben werden oft durch überlange Genehmigungsverfahren ausgebremst – © PixabayDie Wuppertaler Firma Vorwerk baut z. B. ein zweites Thermomix-Werk in Frankreich und spricht deutlich von den günstigen Bedingungen für die Industrie in Frankreich. So schwächen abwandernde Industrien aber auch unsere Städte. „Was allen im Baugewerbe momentan das Genick bricht, sind die Energiepreise“, sagt Radounikli, „sie sind der größte Kostenfaktor, weshalb deutsche Standorte, die eigentlich international tätig sind, Minuszahlen schreiben.“
Genehmigungsverfahren dauern im Schnitt ein halbes Jahr zu lang
Der Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) hat 250 Verfahren aus 27 Branchen der letzten fünf Jahre untersucht und sagt: „Planungs- und Genehmigungsverfahren dauern im Schnitt ein halbes Jahr zu lang.“ Behörden sind permanent überlastet und werden von der Industrie als nicht leistungsfähig eingeschätzt. Beispiel Poststraße in Wuppertal: Die Hauptachse vom Bahnhof aus ist eine Zumutung für alle Besucher der Stadt und wird erst Ende 2024 baufertig. Dabei scheinen die notwendigen Schritte doch klar: Standardisierte Verfahren für mehr Rechtssicherheit, bessere Personalausstattung der Behörden und Gerichte und eine Änderung verschiedener europäischer Umweltrichtlinien- und -verordnungen.
Was den Laien verzweifeln lässt, sehen Fachleute gelassener. „Das Problem ist, man sieht zu viele dieser wartenden Situationen und weiß, wo es hakt“, erklärt Alexia Radounikli. „Wenn man am Ende des Studiums diese Branche betritt, weiß man, dass dieser Zustand ein dauerhafter Zustand ist und man erlebt ihn als Normalität. D.h., dieses Entsetzen, was eigentlich eine natürliche Reaktion sein sollte, empfinden Fachleute nicht.“
 Beim Brückbau vergehen von der Planung bis zur Fertigstellung nicht selten mehr als zehn Jahre – © Pixabay
Beim Brückbau vergehen von der Planung bis zur Fertigstellung nicht selten mehr als zehn Jahre – © PixabayMohamed Fezazi stellt in diesem Zusammenhang eher Fragen wie: „Warum gibt es im Bauamt nicht Experten für Gewerbebauten und Experten für Wohnbauten? Warum gilt das vereinfachte Bauverfahren nicht für mehr Gebäudeklassen? Warum gibt es keinen Fallmanager für bessere Abläufe in der Genehmigungsphase? Warum muss bei ganz normalen Fällen sofort ein Brandschutzsachverständiger her, und warum müssen all diese Fragen an ganz vielen Stellen in der Verwaltung immer hin und herwandern bis sie genehmigt werden können?“ Für ihn steht fest: „Diese ganzen Verfahren könnten schneller abgewickelt werden.“
Nutzungsänderungsantrag braucht keinen Architekten
Im deutschen Antragsdschungel lassen sich einzelne Formblätter nicht mehr unterscheiden. „Z. B. ist das Formular eines Nutzungsänderungsantrags exakt das gleiche, wie ein Bauantrag“, sagt Alexia Radounikli. Der sei in den meisten Kommunen identisch und Nutzer fragten sich, warum man für einen Änderungsantrag unbedingt einen Architekten beauftragen müsse.
Es gehe nicht um eine neue Substanz, denn das Gebäude sei ja bereits baulich erfasst und daher könne eine Prüfung durch das Bauamt erfolgen. „Es muss lediglich die neue Nutzung überprüft werden. Das ist eine organisatorische Prüfung und die könnte deutlich beschleunigt werden“, sagt die Architektin.
 Viel zu oft stehen die Baumaschinen still – © Pixabay
Viel zu oft stehen die Baumaschinen still – © PixabayBauen muss neu gedacht werden
Das Handelsblatt sprach im Mai 2023 von zunehmenden Problemen im Bausektor. Die großen Wohnungsverbände sahen den Neubau in Deutschland sogar vor dem Kollaps. Tanja Siems hat unter dem Titel ‚Stadt vermitteln – Methoden und Werkzeuge für gemeinschaftliches Planen‘ ein Buch herausgebracht, in dem sie neue Wege aufzeigt. „Innerhalb städtebaulicher Planungsprozesse ist das Netzwerken ein wichtiger Bestandteil. Dabei muss man Strategien und Konzeptideen bis hin zu Strukturen und Material neu denken sowie Initiativen und Akteure frühzeitig involvieren“, fordert sie daher. Man müsse zu jeder Zeit offen sein für einen intensiven Austausch mit Fachleuten und den Akteuren der Stadt. Das flexible Denken aller Beteiligten müsse gefördert werden.
Tanja Siems: „Man braucht Gleichgesinnte. Bei unserem multidisziplinären Projekt in Brüssel war es sehr hilfreich, dass wir durch unsere vermittelnden Methoden innerhalb des Planungsprozesses von Anfang an die Verkehrsingenieure, die Landschaftsarchitekten und Sicherheitstechniker auf unserer Seite hatten. Wenn die Hauptperson, die die Verantwortung hat, flexibel denkt und offen arbeitet, ist es gar kein Problem komplexe Systeme umzusetzen. Zum aktuellen und brisanten Thema KI, wenn in Zukunft innerhalb von Planungs- und Bauprozessen künstliche Intelligenz einsetzt wird, brauchen wir fortwährend stets noch den individuellen Menschen als Entscheidungsträger. Erfahrene Architekt*innen und Planende haben immer ein Empfinden dafür, ob etwas funktioniert oder nicht.“
 Bauherrn brauchen jede Menge Geduld bis die Bagger endlich zum Einsatz kommen können – © Pixabay
Bauherrn brauchen jede Menge Geduld bis die Bagger endlich zum Einsatz kommen können – © PixabayGenehmigungsverfahren hinken der Zeit hinterher
Lange Genehmigungsverfahren schaden auch dem Klimawandel, denn für eine wirkungsvolle Klimawende braucht man auch ausgebaute Bahntrassen, modernisierte Straßen für E-Autos und funktionstüchtige Brücken. Von der Idee bis zum Bau dieser Infrastrukturprojekte vergehen mit den derzeitigen Regularien oft mehr als 10 Jahre.
„Ja“, bestätigt Tanja Siems, „aber das liegt daran, dass man auf den alten Prinzipien baut. Ein Beispiel dazu ist die E-Mobilität; man bräuchte eine ganz andere Infrastruktur, da müsste sich die ganze Stadt in kürzester Zeit baulich verändern. Es gibt viele gute und konstruktive Ideen, die aber häufig auch gestoppt werden, weil sich Systeme zu langsam verändern.“
Genehmigungsverfahren seien zudem nur ein Teilaspekt ganz vieler Faktoren, die unseren Lebensraum bestimmten, erklärt Mohamed Fezazi, denn im Gespräch mit jungen Studierenden kämen auch immer wieder neue Ideen zustande, die eine Lösung alter Probleme mit sich brächten. „Die Studierenden haben ein Gespür dafür, wie sich so etwas weiterentwickeln kann. Eine Stadt ist ein hochkomplexes Thema.“
Am Ende jeden Semesters lädt Tanja Siems daher immer wieder Fachleute und Laien ein und gibt den Studierenden die Möglichkeit, Ihre Ergebnisse zu präsentieren.
 Der Baubranche machen nicht nur die hohen Energiekosten zu schaffen – © Pixabay
Der Baubranche machen nicht nur die hohen Energiekosten zu schaffen – © PixabayInformelle Planung ist kreativer Prozess ohne Grenzen
„Baurechtlich gibt es immer eine formelle Planung, die überschaubar ist und erklärt, wo was wie stehen darf. Demgegenüber steht aber die informelle Planung“ sagt Alexia Radounikli, „und da haben wir fast völlige Freiheit und können gestalten. Das ist der Motor, der kreative Prozess, dem keine Grenzen gesetzt sind. Alles, was in diese informellen Planungen aus Bürgerinitiativen, Workshops und Veranstaltungsformaten hineinspielt, muss die gleiche Ernsthaftigkeit haben wie die formelle Planung“. „In der Zeit, in der man etwas entwickelt, entsteht ja schon etwas“, fügt Tanja Siems hinzu. „Das muss ich genauso wichtig nehmen wie das Produkt am Ende. Kleinteilig und flexibel denken, damit ich es auch verändern kann.“
Städtebauliche Möglichkeiten für die Zukunft gibt es genug, es gehe nicht mehr nur um den Masterplan, der unbedingt umgesetzt werden müsse, erklärt die Städtebauerin abschließend. Viele kleine Schritte dazwischen seien wichtig und das sei es, was sie ihren Studierenden auf ihrem Weg in die Berufstätigkeit zeige. Am Anfang aller Projekte steht immer die Kreativität an erster Stelle. Gute Strategien und Konzepte müssen aber auch erkannt werden, damit veraltete Regeln verändert werden können.
Uwe Blass
 Alexia Radounikli, Prof. Dr.-Ing. Tanja Siems und Dipl.-Ing. Mohamed Fezazi (v.l.) – © UniService Transfer
Alexia Radounikli, Prof. Dr.-Ing. Tanja Siems und Dipl.-Ing. Mohamed Fezazi (v.l.) – © UniService TransferÜber Tanja Siems, Alexia Radouniki und Mohamed Fezazi
Professorin Dr.-Ing Tanja Siems leitet den Lehrstuhl für Städtebau an der Bergischen Universität.
Alexia Radounikli (M.SC) promoviert am Lehrstuhl für Städtebau.
Dipl.-Ing. Mohamed Fezazi ist Architekt und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Städtebau.
Weiter mit:




Kommentare
Neuen Kommentar verfassen